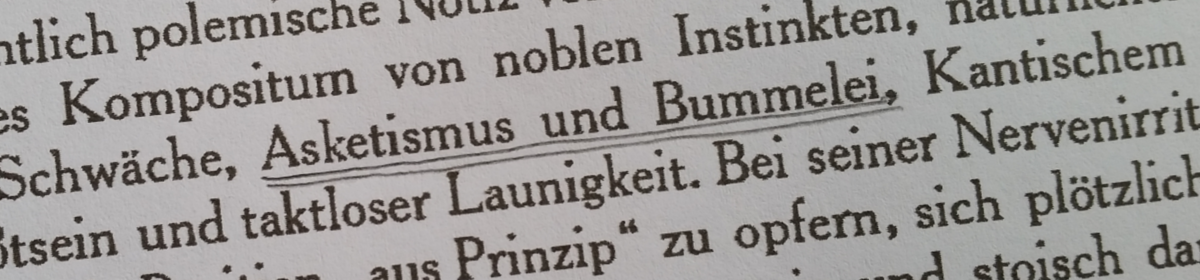Am Donnerstag, dem 18. Oktober 2018 hielt ich beim Linken Bündnis gegen Antisemitismus in München einen Vortrag über das Verhältnis von Rassismuskritik und Antisemitismuskritik. Eine ausformulierter Version des weitgehend frei gehaltenen Vortrags dokumentiere ich in drei Teilen. In diesem ersten Teil geht es um die theoretischen und politischen Hintergründe, vor denen Rassismuskritik und Antisemitismuskritik formuliert werden; im folgenden zweiten Teil stelle ich die Begriffe von Rassismus und Antisemitismus dar, die mit diesen Perspektiven einhergehen; im abschließenden dritten Teil stelle ich dann die konfligierenden Positionen zum Thema Israel und Islam gegenüber.
(Anmerkung: Ich bin nie dazu gekommen, den hier versprochenen dritten Teil für den Blog aufzubereiten. Der komplette Text findet sich in unterschiedlichen Versionen in diesem Peripherie-Artikel sowie in meinem Beitrag zum Sammelband Beißreflexe.)
Man muss keine Bewegungssoziologin sein, um zu wissen, dass es in der deutschsprachigen Linken immer und immer wieder zu Konflikten zwischen Antisemitismuskritikerinnen und Rassismuskritikerinnen kommt. Solche Streitigkeiten treten im Kontext von Demonstrationen, Bündnissen, Zeitschriften, Diskussionsveranstaltungen, Hochschulseminaren, Social-Media-Diskussionen usw. seit fast 20 Jahren so regelmäßig auf, dass die allermeisten, die sich in den entsprechenden Kontexten bewegen, ihnen schon einmal in der einen oder anderen Weise begegnet sein dürften.
Nimmt man einen naiven Blick ein, sind diese Konflikte höchst überraschend – und ich schätze wir alle waren überrascht, als wir das erste Mal im Leben mit ihnen konfrontiert waren. Schließlich sind wir, abstrakt gesprochen, alle „gegen Antisemitismus“ und „gegen Rassismus“. Diese doppelte Abgrenzung ist ein No Brainer. Tatsächlich würden auch die allermeisten der im folgenden dargestellten Antisemitismuskritiker_innen ohne zu zögern erklären, dass auch sie nicht etwa Rassist_innen, sondern überzeugte Gegner_innen des Rassismus sind. Für Rassismuskritiker_innen gilt Analoges in Bezug auf Antisemitismus.
Die Grundlage des Konfliktes besteht entsprechend nicht etwa in einem mangelnden Bekenntnis gegen Rassismus oder Antisemitismus, sondern darin, dass die Konfliktparteien etwas völlig anderes unter beidem verstehen – ebenso unter Kritik, unter Linkssein, unter wünschenswerter Politik usw.
Fangen wir aber nicht mit der Theorie an, sondern mit dem relativ Konkreten, nämlich mit den Themenfeldern, auf denen diese Konflikte immer wieder auftreten. Dies sind die beiden üblich-verdächtigen, nämlich Israel und der Islam.
Wenn es um Israel geht, sehen Antisemitismuskritikerinnen in erster Linie den Staat der Shoah-Überlebenden, der gegen antisemitische Feind_innen um seine Existenz kämpft. Rassismuskritiker_innen sehen dagegen in Israel eher einen Staat mit kolonialer Vorgeschichte, der die arabische Bevölkerung rassistisch unterdrückt und verdrängt. Taucht daher auf einer linken Demonstration in Deutschland eine Israelflagge auf, ist das den einen ein selbstverständliches Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Antisemitismus; den anderen ist es ein Symbol rassistischer Unterdrückung. Tauchen ein „Palästinensertuch“ oder eine palästinensische Flagge auf, gilt das den einen als antisemitische Mikroaggression, den anderen als selbstverständliches Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Rassismus und Kolonialismus.
Wenn es um den Islam geht, heben Antisemitismuskritiker_innen insbesondere die Gefahr hervor, die vom Antisemitismus ausgeht, der unter Musliminnen in Europa und weltweit besonders verbreitet ist – oft verhandelt unter dem Stichwort „Neuer Antisemitismus“. Entsprechend sehen sie einen besonders dringlichen Bedarf, diesen Antisemitismus öffentlich zu kritisieren. Rassismuskritiker_innen dagegen sehen im Islam in erster Linie die Religion einer rassistisch marginalisierten Minderheit im Westen und ehemaliger Kolonien im Rest der Welt. Diskussionen über islamischen oder „Neuen“ Antisemitismus gelten ihnen entsprechend als Beiträge zur weiteren Stigmatisierung und Marginalisierung dieser Minderheitenreligion, als Fortschreibung kolonialer Dämonisierung anderer Länder sowie als Reinwaschung der westlichen Mehrheitsgesellschaft.
Freilich ist diese Gegenüberstellung zugespitzt: Zum Glück lassen sich die größten Teile der deutschsprachigen Linken nicht umstandslos einer dieser Seiten zuordnen. Von der knappen Viertelmillion Menschen, die am vergangenen Samstag in Berlin unter dem Motto #unteilbar auf der Straße war, dürfe sich die übergroße Mehrheit weder auf der einen noch der anderen Seite verorten, sondern in einem vagen Dazwischen. Dieses vage Dazwischenstehen ist sicherlich sehr viel besser, als wenn sich diese Massen eine der beiden Positionen in völliger Kohärenz aneigneten. Noch wünschenswerter wäre aber ein reflektierter Umgang mit diesen Konflikten und eine Bereitschaft, von beiden Seiten zu lernen – denn es gibt von beiden Seiten etwas zu lernen.
Um zu einem solchen reflektierten Umgang zu gelangen, ist es dienlich, die überspitzt-binäre Konstruktion noch etwas weiter fortzuführen und beide Seiten idealtypisch gegeneinander zu konturieren. Dies tue ich im Folgenden in drei Bereichen: Erstens in Bezug auf die theoretischen und politischen Hintergrundannahmen beider Positionen, zweitens in Bezug auf die jeweiligen Verständnisse von Rassismus und Antisemitismus und drittens in Bezug auf die eben genannten, üblich-verdächtigen Konfliktfelder.
Wenn ich im Folgenden von der Rassismuskritik und der Antisemitismuskritik spreche, beziehe ich mich (ohne das jedes Mal neu zu betonen) de facto auf zwei sehr viel spezifischere Positionen, nämlich auf eine postkoloniale Rassismuskritik und auf eine (post-)antideutsche Antisemitismuskritik. Andere Perspektiven bleiben dabei außen vor. Entsprechend geht es mir auch nicht darum, die Diskussionen um den Nahostkonflikt oder den Islam in der deutschen Linken historisch-genetisch zu rekonstruieren, sondern nur darum diese beiden Positionen gegeneinander zu konturieren.
Ich selbst kann dabei freilich nicht aus der Vogelperspektive einer göttlich-neutralen Schiedsrichter_in sprechen. Ich habe meine politische Sozialisation ganz eindeutig in antisemitismuskritischen Kontexten erhalten. Auch wenn ich mich in den letzten Jahren verstärkt für rassismuskritische Positionen geöffnet und viel von diesen gelernt habe, merke ich mir diese Sozialisation nach wie vor ganz deutlich an. Entsprechend stehe ich beiden Positionen nicht neutral gegenüber. Allerdings will ich mich in den folgenden Ausführungen zunächst eines methodischen Relativismus bedienen. Ich will nicht mit einem feststehenden Urteil darüber anfangen, welcher der beiden Ansätzen besser oder was an beiden haltbar und unhaltbar ist. Vielmehr stelle ich sie zunächst so distanziert wie möglich nebeneinander, um mir meine – dann hoffentlich hinreichend in der Sache begründeten und nachvollziehbaren – Urteile für das Ende aufzuheben.
Teil I: Die theoretischen und politischen Hintergründe

1 Theoretische Perspektiven
Antisemitismuskritik und Rassismuskritik werden in unterschiedlichen Theoriesprachen formuliert. Der Zusammenhang zwischen Theorie, Gegenstand und Form der Kritik ist sicherlich nicht in dem Sinne deduktiv, dass am Anfang der theoretische Zugriff und am Ende die politische Position stünde. Vielmehr ist von einem Wechselverhältnis auszugehen. Für die Darstellung bietet es sich dennoch an, mit der theoretischen Position zu beginnen. Dabei sind die folgenden skizzenhaften Darstellungen freilich keineswegs mit dem Anspruch formuliert, kritische Theorie bzw. Poststrukturalismus und Postkolonialismus angemessen zu rekonstruieren. Vielmehr sollen zentrale Punkte der in Antisemitismuskritik und Rassismuskritik vorherrschenden Lesarten dieser Theorien idealtypisch skizziert werden.
1.1 Kritische Theorie, Sozialpsychologie und Ideologiekritik
Die für die oben skizzierten Konflikte wichtigsten Linien der Antisemitismuskritik sehen sich in der Tradition der kritischen Theorie und nehmen zumeist sozialpsychologische und ideologiekritische Perspektiven ein. Die wichtigsten Referenztheoretikerinnen sind dann Karl Marx, Sigmund Freud, Theodor Adorno und Max Horkheimer – mit einigen Abstrichen auch Hannah Arendt. Im Mittelpunkt dieses Denkens stehen eine emphatische Bezugnahme auf Vernunft und die Idee des autonomen Individuums.
Der Blick auf die Moderne ist dabei dialektisch: Einerseits wird betont, dass die Geistesgeschichte der westlichen Moderne die Ideale von Vernunft und individueller Autonomie selbst in den Mittelpunkt gestellt habe, was begrüßenswert sei. Andererseits moniert man, dass diese Ideale in der sozialen Realität bislang allenfalls höchst einseitig realisiert seien. Diese Nicht-Realisierung sei kein bloßer Zufall und keine einfach zu behebende Unvollständigkeit, sondern liege letztlich in der Form begründet, in der diese Ideale formuliert sind: Diese sei untrennbar mit sozialen Institutionen verbunden, die die Realisierung von Vernunft und Selbstbestimmung systematisch unterminierten – namentlich mit kapitalistischer Ökonomie und nationaler Staatlichkeit. Nichtsdestotrotz will man Vernunft und Autonomie nicht aufgeben oder auf ihren Status als „bürgerliche Ideologie“ reduzieren, sondern ihre weitestmögliche Realisierung anstreben.
Jedoch wird das Bild der Moderne noch problematischer: Die Moderne setze der Realisierung ihrer eigenen Ideale nicht nur Grenzen, sondern trage auch den Keim zum „Rückfall“ oder zur „negativen Aufhebung“ in sich, zur totalitären Auslöschung von Individualität und Vernunft, wie sie im Nationalsozialismus stattgefunden habe.
Die kritische Praxis dieser kritischen Theorie besteht in erster Linie in Ideologiekritik: Man nimmt die vorherrschenden Bewusstseinsformationen in den Blick und versucht darzulegen, wie sich diese zu Vernunft und Selbstbestimmung, zu ihren Grenzen in der sozialen Praxis und der Gefahr ihrer Auslöschung verhalten. Dabei spielt die in psychoanalytischen und marxistischen Kategorien vorgenommene Spekulation, welche sozialen Verhältnisse dabei mit welchen psychischen Mechanismen wie verarbeitet werden eine entscheidende Rolle.
1.2 Poststrukturalismus, Postkolonialismus, Diskurs- und Machtanalyse
Die Rassismuskritik wird dagegen eher vor dem Hintergrund poststrukturalistische und postkolonialer Theorien formuliert, der kritische Zugriff erfolgt eher mit Mitteln der Diskurs- und Machtanalyse. Die Referenztheoretikerinnen sind Michel Foucault, Jacques Derrida, Edward Said, Stuart Hall oder Gayatri Spivak.
Diese Theorien werden in ihrer Kritik der Moderne dabei zumeist entschieden nicht-dialektisch gelesen. Dann geht es nicht darum, die Begriffe von Vernunft und Autonomie zu bejahen, zu retten oder zu realisieren. Stattdessen geht es darum, in gnadenloser Negativität aufzuzeigen, wie die in Begriffen von Vernunft und Autonomie gerechtfertigte Welt- und Gesellschaftsordnung systematisch Privilegierungen und Marginalisierungen hervorbringt, also die Lebenschancen einiger Subjekte verbessert und die anderer Subjekte verschlechtert.
Diese Prozesse werden weniger durch eine psychoanalytische Diskussion von Prozessen in den Köpfen der Subjekte betrachtet, sondern eher durch eine Diskussion von Machtverhältnissen und den mit ihnen verbundenen Diskursen. Es geht um die Frage, wer aus welcher Position über wen was sagen kann und sagt und wie dies die Machtverhältnisse stabilisiert oder unterminiert.
2 Politische Perspektiven
Entsprechend haben Antisemitismuskritik und Rassismuskritik auch ganz unterschiedliche Verständnisse von dem, was links, emanzipatorisch oder kritisch, kurz was eine wünschenswerte politische Praxis ist.
2.1 Der Kampf gegen die Kräfte des Rückfalls
Passend zu ihrem dialektischen Blick auf die Moderne halten die kritisch-theoretisch orientierten Antisemitismuskritikerinnen eine politische Praxis für wünschenswert, die auf Vernunft und Autonomie zielt.
Die optimistischsten Vetreterinnen dieser Perspektive hoffen dann darauf, das, was an der westlichen Moderne wahr, rational und positiv ist, nicht nur zu erhalten, sondern in einer ganz neuen Weise umzusetzen. Dann ginge es darum, die Widersprüche der Moderne und insbesondere den Kapitalismus zu überwinden und zu einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft zu gelangen. Mit anderen Worten sind dies Kommunist_innen. Die nicht ganz so optimistischen Vertreterinnen glauben nicht an eine solche ganz und gar vernünftige Gesellschaft, die die Widersprüche der Moderne überwunden haben wird. Sie hoffen jedoch darauf, mit Reformen darauf hinzuwirken, die vernünftigen Momente der westlichen Moderne nach und nach zu vertiefen und auszuweiten – mit anderen Worten handelt es sich um Linksliberale. Die pessimistischen Vertreterinnen glauben auch an diesen langsamen Fortschritt nicht wirklich und sehen stattdessen Kräfte auf dem Vormarsch, die sie mit einem „Rückfall“ identifizieren. Ihnen geht es dann primär darum, diese Regression zu verhindern – eine Praxis, die man liberal-konservativ nennen könnte. Unabhängig wie „optimistisch“ diese Antisemitismuskritikerinnen im Abstrakten sind, gehen die meisten im Konkreten davon aus, dass es aktuell keine wirkmächtigen sozialen Akteurinnen gibt, die mit ernsthafter Erfolgsaussicht für eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft kämpften.
Der Blick auf politische Konflikte ist unter Antisemitismuskritikerinnen entsprechend oft davon geprägt, dass man in ihnen Kämpfe zwischen Mächten, die das liberale Erbe der Moderne erhalten wollen, auf der einen Seite und Mächten, die für einen „Rückfall“ stehen, auf der anderen Seite sieht.
Nimmt man einen solchen Blick auf die Welt ein, ist klar, dass man seine Solidarität nicht unbedingt so verteilt, dass man mit den Schwachen gegen die Starken steht. Vielmehr achtet man in erster Linie darauf, für welche Ideale und für welche Einrichtung der Welt die jeweiligen Akteurinnen inhaltlich kämpfen. Solidarität gebührt aus dieser Perspektive in erster Linie denjenigen, die zumindest für die westlich-modernen Ideale von Vernunft und Autonomie kämpfen; Feindschaft gebührt denen, die diese Ideale sogar noch in ihrer unvollständigen Form ablehnen und bekämpfen.
Dazu passt, dass nicht wenige Antisemitismuskritikerinnen sowohl 1991 als auch 2003 die US-geführten Interventionen im Irak begrüßten: Jeweils sah man eine Macht, die für die Werte bürgerlicher Freiheit steht, im Kampf gegen ein antisemitisches Regime, das für den totalitären Rückfall steht.
2.2 Die Solidarität mit den Schwachen und Unterdrückten
Mit dem anderen Blick auf die Moderne, den die Vertreterinnen der Rassismuskritik haben, geht auch ein anderes Verständnis von dem, was links oder was wünschenswerte Politik ist, einher. Weil die Moderne hier in erster Linie als ein Apparat gilt, der in machtvollen Prozessen Ungleichheiten produziert, das Leben der einen aufwertet und verbessert, das der anderen aber abwertet und verschlechtert, blickt man entsprechend auf politische Konflikte.
Aus dieser Sicht liegt es nahe, sich konsequent auf die Seiten der Marginalisierten und Ausgeschlossenen zu stellen, die sich gegen auf ihre je eigene Weise gegen Unterdrückung wehren. Die inhaltlichen Ziele, die die einzelnen Akteurinnen formulieren, treten dabei in den Hintergrund. Mehr noch: Führt ein westliches Land einen Krieg und legitimiert dies als eine Verbreitung von Freiheit oder Demokratie, erscheint dies als ein deutliches Anzeichen von neokolonialer Gewalt – denn auch die Kolonialmächte legitimierten ihre Gewalt entsprechend. Somit gilt die Bezugnahme auf diese Ideale eher als Verdachtsmoment. Von widerständigen Akteurinnen wird andersherum auch nicht verlangt, dass sie sich zu diesen Idealen bekennen, mit denen doch ihre Unterdrückung begründet wurde.
Auch diese Perspektive liegt freilich in mehreren Varianten vor. Nur die Wenigsten legen sie so radikal aus, dass noch das reale Tun von Islamistinnen als legitimer antikolonialer Widerstand verstanden wird. Manche stehen auch aus einer solchen Perspektive gegen reaktionäre Bewegungen in den ehemaligen Kolonien oder marginalisierten Minderheiten – dafür muss man nur konsequent genug sein und auch Hierarchisierungs- und Marginalisierungsprozesse in diesen Ländern oder „Communities“ in den Blick nehmen, wie es zum Beispiel Spivak verlangt. Andere weichen diesen Ambivalenzen aus, indem sie die Praxis islamistischer und ähnlicher Bewegungen stark verzerrt darstellen, sodass deren Grausamkeiten auf der Rechnung nicht erscheinen. Wieder andere umgehen das Problem, indem sie gewalttätige djihadistische Organisationen wie al-Qaeda und der IS dem Imperialismus zuschlagen, ohne den sie nicht existieren könnten.
Bei all diesen Differenzierungen bleibt festzuhalten, dass über die Zuteilung von Solidarität aus dieser Perspektive weniger anhand des Bekenntnisses zu bestimmten Werten von Vernunft und Autonomie als anhand des Status der Marginalisierung entschieden wird. Solidarität gilt in erster Linie nicht den „fortschrittlichen“ Kräften, sondern den Schwachen. Entsprechend wäre hier auch 1991 und 2003 kaum jemand auf die Idee gekommen, der US-geführten Koalition zuzujubeln (nicht einmal aus Solidarität mit der kurdischen Minderheit) – ohne dass allerdings allzu viele im Umkehrschluss dem Baath-Regime zugejubelt hätten.
3 Historische Perspektiven
Beide Perspektiven haben gemeinsam, dass ihr Blick auf die Moderne durch ein großes Verbrechen geprägt ist, das sich auf keinen Fall wiederholen darf bzw. endlich beendet werden sollte.
3.1 Die Shoah als einmaliges Menschheitsverbrechen und Zivilisationsbruch
Im Falle der Antisemitismuskritik ist dies eindeutig die Shoah, die als Realisierung aller zerstörerischen und regressiven Potenziale der Moderne gilt, als „Rückfall“ hinter diese Moderne oder als ihre „negative Aufhebung“.
Besonders hervorgehoben wird dabei, dass die nationalsozialistische Judenvernichtung ein Selbstzweck gewesen sei. Somit habe sie nicht nur gegen die ethischen Maßstäbe der praktischen Vernunft verstoßen, sondern sogar noch die Maßstäbe instrumentell-partikularer Vernunft unterlaufen. Täterinnen, Opfer und Beobachterinnen hätten zuvor in der selbstverständlichen Annahme gelebt, dass Menschen anderen Menschen womöglich Schaden zufügen, aber nur wenn ihnen dies bei der egoistischen Verfolgung der eigenen Ziele nütze. Dass die Schädigung und Vernichtung von Menschen aber in der Shoah selbst zum Zweck geworden sei, sei ein Bruch mit dieser Selbstverständlichkeit, ein “Zivilisationsbruch”, wie es Dan Diner nannte.
Entsprechend fühlen sich Antisemitismuskritikerinnen an den kategorischen Imperativ gebunden, den „Hitler“ Adorno zufolge den Menschen „im Stande ihrer Unfreiheit […] aufgezwungen“ habe, nämlich „Denken und Handeln so einzurichten, das Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe“. Während diese Formulierung Adornos die Gefahr von „Ähnlichem“ zumindest in der Zukunft explizit benennt, wird in der Antisemitismuskritik immer wieder die Einmaligkeit oder Singularität der Judenvernichtung betont, die zumindest mit keinen vorhergehenden Verbrechen vergleichbar sei.
3.2 Der Kolonialismus als Menschheitsverbrechen und Kernelement der Moderne
Der Gegenseite ist die Behauptung einer solchen Einmaligkeit ebenso suspekt wie die Rede von einem “Zivilisationsbruch”. Für Rassismuskritikerinnen ist die Shoah ebenfalls ein großes Verbrechen, das sich nicht wiederholen darf. Jedoch reiht es sich aus dieser Sicht relativ bruchlos in die Verbrechen und Völkermorde ein, die im Kontext des europäischen Kolonialismus begangen wurden.
Die Rede von der Einmaligkeit ist aus dieser Sicht nicht nur falsch, sie ist auch selbst Teil des Problems. Denn der größte Unterschied zwischen der Shoah und den Kolonialverbrechen habe darin bestanden, dass die Opfer hier Europäerinnen gewesen seien. Indem diesen Europäerinnen nun ein Sonderstatus zugestanden werde, reproduziere man wiederum die kolonialrassistische Ideologie, der zufolge das Leben von Europäerinnen mehr wert ist als das von anderen Menschen. Auschwitz sei kein Zivilisationsbruch, weil es die damit implizierte ungebrochene Zivilisation nie gegeben habe.
Als das Menschheitsverbrechen, das die Moderne prägt, gilt hier dementsprechend der Kolonialismus insgesamt. Dabei geht man davon aus, dass die Moderne ohne den Kolonialismus gar nicht in dieser Form hätte existieren können. Der Westen sei nicht etwa wegen seines fortschrittlichen und aufgeklärten Denkens zum Mittelpunkt der Welt geworden, sondern aufgrund der Ausbeutung und Unterdrückung aller anderen. Das aufgeklärte Denken habe hierfür eine Rechtfertigung geliefert und diene heute noch der Verschleierung.
Dieser Kolonialismus habe in der formalen Dekolonialisierung dann nicht etwa sein Ende gefunden, sondern präge die Welt immer noch weiter. Nach wie vor seien die ehemaligen Kolonialmächte dominant, nach wie vor seien die ehemaligen Kolonien untergeordnet. Demnach ist es nicht nur so, dass die Wiederholung des Kolonialismus verhindert werden müsste. Vielmehr müsste seiner ständigen Fortsetzung ein Ende bereitet werden.