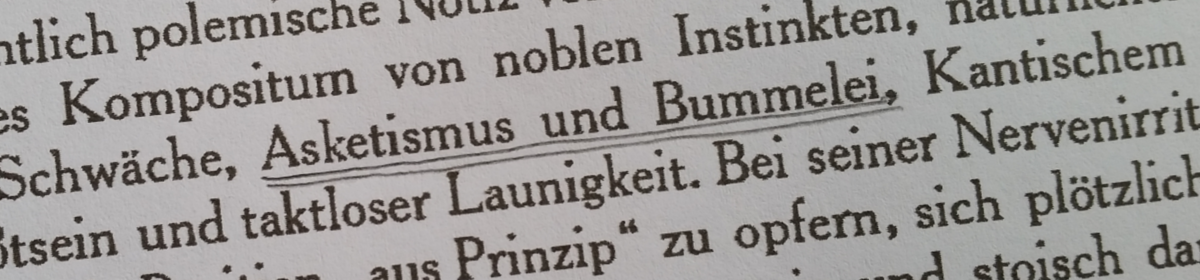Die Frühjahrstagung der Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft fand dieses Jahr in Bremen unter dem Titel „Demokratie und Wahrheit“ statt. Anhand von Jürgen Habermas‘ politischer Theorie kultureller Differenz im demokratischen Verfassungsstaat und der deutschen Beschneidungsdebatte aus dem Jahr 2012 vertrat ich in meinem Paper die These, dass die demokratische Öffentlichkeit auf eine Orientierung an propositionaler Wahrheit und Wahrhaftigkeit angewiesen ist, ein zu starker Fokus auf diese Fragen aber von den mindestens ebenso wichtigen Kriterien der Inklusivität und Gleichheit in der Debatte abzulenken droht. Im Folgenden dokumentiere ich mein leicht überarbeitetes Redemanuskript.
Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen zu dem Panel gekommen seid, obwohl es nur aus mir besteht. Worauf Sie sich damit einlassen, ist, wie Sie dem Untertitel entnehmen können, eine kleine politische Theorie der männlichen Vorhaut.
Politisch-theoretisch vertrete ich dabei vier Thesen rund um das Verhältnis von Demokratie, öffentlicher Debatte und Wahrheit. Weil die ersten beiden nach dem gestern Gesagten ein wenig banal sind, habe ich als dritte eine weniger banale gewählt, von der ich noch sehen muss, mit welcher Konsequenz ich sie selbst vertrete. Die vierte ist das, was ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit sage.
- Für Demokratie ist es wichtig, dass in öffentlichen Debatten eine Orientierung an propositionaler Wahrheit bzw. an Wahrhaftigkeit (in einem schwachen, nichtmetaphysischen Sinne verstanden) vorherrscht und entsprechende Verfehlungen skandalisiert und sanktioniert werden.
- Ein zu starker Fokus auf diese Frage von Wahrheit und Wahrhaftigkeit droht jedoch, von einem mindestens ebenso wichtigen Kriterium für die demokratische Qualität öffentlicher Debatten abzulenken, nämlich von der Frage, wer über wen welche Wahrheiten produzieren kann.
- Wenn reale Debatten gemessen an den Maßstäben aus 1. und 2. eine bestimmte Qualität unterschreiten, kann es normativ wünschenswerter sein, sie würden gar nicht erst geführt.
- Politische Theorie muss sich – insbesondere, wenn sie realen Diskursen und Aushandlungen normatives Gewicht aufbürdet – für eine gesellschaftstheoretische und ideologiekritische Reflexion öffnen, um nicht selbst ideologische Effekte zu zeitigen.
Diese vier Thesen möchte ich mit einer Lektüre von Jürgen Habermas begründen, bei der ich entgegen seinem ausdrücklichen Wunsch Texte des Theoretikers Jürgen Habermas mit Aussagen des öffentlichen Intellektuellen Jürgen Habermas verbinde. Jedoch tue ich das gerade nicht, um Widersprüchlichkeit zu entlarven, sondern um theoretische Reflexion voranzutreiben. Mein theoretisches Argument illustriere ich anhand der deutschen Beschneidungsdebatte aus dem Jahr 2012.
Mein weiteres Vorgehen ist in fünf Schritte gegliedert. Im ersten Schritt skizziere ich, wie der politische Theoretiker Jürgen Habermas auf kulturelle Differenz sowie das damit einhergehende Konfliktpotenzial in Demokratien blickt und welche Rolle er dabei den öffentlichen Debatten zuspricht. Im zweiten Schritt rekapituliere ich die deutsche Beschneidungsdebatte aus dem Jahr 2012 und erläutere, inwieweit es sich dabei um einen idealen Fall für öffentliche Aushandlungen in Habermas‘ Sinne zu handeln scheint. Im dritten Schritt gehe ich darauf ein, wie der öffentliche Intellektuelle Jürgen Habermas die ganze Debatte als grundsätzlich verfehlt einordnet und wie der deutsche Bundestag sie mit einem Federstrich beendet. Im vierten Schritt erläutere ich unter Hinzuziehung von Theoremen aus der postkolonialen Theorie, welche guten Gründe es für diese Zurückweisung der Debatte gibt. Im abschließenden sechsten Schritt begründe ich auf dieser Basis kurz meine Thesen und lasse am Ende den Gesellschaftstheoretiker Jürgen Habermas auf weißem Rosse auf die Bühne reiten, um den politischen Theoretiker, den öffentlichen Intellektuellen, den Bundestag und die postkoloniale Kritik in Harmonie zu einen.
Inhalt
1 Der politische Theoretiker Jürgen Habermas und das Problem kultureller Differenz im demokratischen Verfassungsstaat
Dem Phänomen kultureller Differenz als Quelle politischer Konflikte und politisch-theoretischer Probleme widmet sich Jürgen Habermas insbesondere in den frühen 1990ern im Anschluss an die Multikulturalismus- und Kommunitarismusdebatten. Die meisten relevanten Aufsätze sind im Sammelband Die Einbeziehung des Anderen versammelt; später formulierte er sehr ähnliche Thesen in Bezug auf religiöse Differenz.
Habermas zufolge ist kulturelle Differenz in modernen Demokratien ein unthintergehbares Faktum. Dieses Faktum hebe das normative Modell des demokratischen Verfassungsstaats nicht aus den Angeln, stelle es aber doch vor Herausforderungen, die einer politischen Bearbeitung bedürften. Habermas nennt diverse Formen solcher zu bearbeitenden Konflikte; eine davon ist wie in meinem Fallbeispiel die Frage, ob bestimmte, von einzelnen Gruppen mit kultureller Legitimation vollzogene, aber gesamtgesellschaftlich umstrittene Praktiken toleriert oder verboten werden sollten.
Als prozeduralistischer politischer Theoretiker will Habermas solche Entscheidungen nicht selbst treffen und auch keinen unmittelbaren substanziellen Kriterienkatalog vorgeben, nach dem zu entscheiden wäre. Stattdessen sollen die Entscheidungen von den realen Bürger_innen in realen Aushandlungen getroffen werden. Jedoch sollen diese Entscheidungsprozesse nicht irgendwie vonstattengehen, sondern gewissen prozeduralen Kriterien genügen – und über eben diese Kriterien reflektiert die politische Theorie.
Was sind nun also die Kriterien, nach denen eine Entscheidung über ein mögliches Verbot einer von einer Minderheit vollzogenen und kulturell legitimierten Praxis, legitim gefällt werden darf?
Zunächst dürfen die das Verbot begründenden Einwände gegen eine solche Praxis nie bloß ethisch sein, das heißt auf den partikularen Werten einer anderen kulturellen Tradition beruhen. Dies wäre nur ein Kulturkampf zwischen verschiedenen Partikularismen. Damit, dass Andere Praktiken vollziehen, die man selbst ethisch nicht gut findet, muss man in einem demokratischen Verfassungsstaat leben – hier ist Toleranz gefordert.
Eine kulturelle Praxis darf nur verboten werden, wenn die Einwände dagegen nicht bloß ethischer, sondern moralischer Natur sind. Moralisch sind Einwände bei Habermas, wenn sie auf universalisierbaren Normen basieren und auf Fragen der Gerechtigkeit zielen, also etwa problematisieren, dass bestimmte Praktiken die Würde oder Grundrechte von Personen verletzen.
Die Entscheidung darüber, ob Einwände gegen eine Praxis nun nur ethisch und partikular oder doch moralisch und universalisierbar sind, ist freilich alles andere als trivial. Habermas weiß beispielsweise selbst sehr gut, dass auch der Begriff der Menschenwürde einer bestimmten kulturellen Tradition entstammt, hält ihn aber nichtsdestotrotz für universalisierbar.
Die Entscheidung darüber, ob Einwände bzw. Normen als moralisch oder als nur ethisch zu bezeichnen sind, muss wiederum in realen gesellschaftlichen Aushandlungen getroffen werden. Als moralisch können Normen gelten, wenn sie sich in Aushandlungen als valide erweisen, die dem Diskursprinzip D und der Universalisierungsgrundsatz U genügen.
D zufolge dürfen „nur die Normen Geltung beanspruchen […], die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmerinnen eines praktischen Diskurses finden können“ (EA 49). U bedeutet, dass alle Diskursteilnehmer_innen so argumentieren müssen, „daß eine Norm genau dann gültig ist, wenn die voraussichtlichen Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Interessenlagen und Wertorientierungen eines jeden voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen gemeinsam zwanglos akzeptiert werden könnten“ (EA 60).
Habermas weiß wiederum, dass eine große Fallhöhe zwischen diesen Prinzipien und der politischen Realität besteht und dass politische Entscheidungen über potenzielle Verbote nicht auf einen realen diskursiven Konsens aller potenziell Betroffenen warten können – sonst könnte kein Einwand je als universalisierbar gelten und das Toleranzgebot würde faktisch universell. Als politischen Vorgriff auf den Konsens nennt Habermas dann die demokratische Mehrheitsregel.
Das heißt dann natürlich pikanterweise, dass kulturelle Mehrheiten zwar nicht nach ihren nur ethischen Einwänden über die Praktiken von Minderheiten entscheiden können. Jedoch können sie in einer Mehrheitsentscheidung de facto darüber entscheiden, ob ihre Einwände nun nur ethisch oder doch moralisch und ergo universalisierbar sind. Das heißt freilich nicht, dass die politische Theorie keine Unterscheidung mehr zwischen Mehrheitstyrannei einerseits und der immer unperfekten Demokratie andererseits treffen könnte. Das Unterscheidungskriterium besteht Habermas zufolge eben darin, dass der Mehrheitsentscheidung „hinreichend diskursiv geführte[…] Auseinandersetzungen“ (EA 323) vorangegangen sein müssen. In anderen Worten: Es muss zumindest ein bisschen D und U erkennbar gewesen sein.
Jetzt habe ich lange genug am Verhältnis von Demokratie und Wahrheit vorbeigeredet. In Die Einbeziehung des Anderen geht Habermas nicht groß darauf ein, dass in solchen Aushandlungen eine Orientierung an Wahrheit bzw. Wahrhaftigkeit vorherrschen soll. Das ist aber nicht deshalb so, weil es ihm egal wäre, sondern weil es zu selbstverständlich ist, als dass es erwähnt werden müsste.
Freilich lassen sich Entscheidungen über das Verbot einer kulturellen Praxis nicht auf epistemische Fragen reduzieren: Zuvorderst geht es nicht um propositionale Wahrheitsansprüche, sondern um normative Richtigkeitsansprüche, nämlich darum, ob eine bestimmte Praxis normativ zu rechtfertigen ist oder nicht. Jedoch kann diese normative Frage nur beantwortet werden, wenn ein halbwegs realistisches Bild von dieser Praxis und ihren Varianten gezeichnet wird – sonst ist ihre Übereinstimmung mit Normen schlicht nicht zu entscheiden. Damit hat die Entscheidung eine epistemische bzw. kognitive Dimension und hängt neben normativen Richtigkeitsansprüchen auch von propositionalen Wahrheitsansprüchen ab. Wenn die Subjekte in Aushandlungen ständig aus Achtlosigkeit oder Täuschungsabsicht oder Verblendung die Unwahrheit sagten, ohne dass dies problematisiert würde, blieben D und U wirkungslos.
In seinem späteren Aufsatz über Toleranz nimmt Habermas dies insofern auf, als er festhält, dass man reale Einwände gegen die Praxis der Anderen haben muss, um überhaupt tolerant sein zu können, „Vorurteile zählen nicht“ (NR 265).
Diese epistemische Dimension solcher Aushandlungen mache ich gleich an meinem Fallbeispiel noch deutlicher.
2 Die deutsche Beschneidungsdebatte von 2012
Die deutsche Beschneidungsdebatte von 2012 ist auf den ersten Blick ein idealtypisches Beispiel für eine solche Aushandlung in Habermas‘ Sinne.
Einige Tage nach der Beschneidung eines vierjährigen muslimischen Jungen kam zu Komplikationen, weshalb die Mutter mit ihm ein Krankenhaus aufsuchte. Als die Staatsanwaltschaft Köln davon erfuhr, erhob sie Anklage wegen Körperverletzung gegen den ebenfalls muslimischen Arzt, der die Beschneidung vorgenommen hatte. Das Landgericht Köln sah den Straftatbestand nach geltendem Recht erfüllt und sprach den Arzt im Mai 2012 nur mit der Begründung frei, dass er sich im Rechtsirrtum befunden habe, also aufrichtig, aber irrtümlich von der Legalität seines Handelns ausgegangen sei. Dieser Freispruch wiederum führte dazu, dass der Angeklagte keine Berufung einlegen konnte und das Urteil damit sofort und unanfechtbar rechtskräftig wurde. Damit hatten auch die betroffenen Religionsgemeinschaften keine Möglichkeit, eine Anfechtung des Urteils auf Rechtsweg zu unterstützen und bis auf weiteres mussten Beschneidungen in Deutschland als strafbare Körperverletzung gelten.
Das Urteil löste eine heftige öffentliche Debatte aus, in der darüber diskutiert wurde, ob die Beschneidung von Jungen in Deutschland legal sein sollte oder nicht. Dies wurde zumeist als Abwägung von Rechtsgütern mit Grundrechtsrang formuliert: auf der einen Seite steht das Recht des Jungen auf körperliche Unversehrtheit, auf der anderen Seite stehen Elternrecht und Religionsfreiheit – all diese Rechte sind im Grundgesetz als durch die Ewigkeitsklausel geschützte Grundrechte verankert. So gesprochen sind es auf beiden Seiten Normen, die in der Habermas’schen Sprache als moralisch und universalisierbar gelten müssten. Die öffentlich diskutierte Frage war entsprechend zumeist, welches dieser Rechtsgüter das andere unter welchen Bedingungen übertrumpft.
Nichtsdestotrotz handelt es sich hier gleichsam um eine Aushandlung über die Legalität einer kulturellen Praxis von Minderheiten in Habermas‘ Sinne. Dieser beschrieb einen möglichen Konflikt in Die Einbeziehung des Anderen folgendermaßen: „Nötigenfalls müssen in Deutschland nicht nur die Rechte türkischer Mädchen gegen den Willen von Vätern, die sich auf Prärogativen ihrer Herkunftskultur berufen, durchgesetzt werden, sondern überhaupt individuelle Rechte gegen Kollektivansprüche, die einem nationalistischen Selbstverständnis entspringen“ (EA 332).
Dies kann freilich nicht nur für türkische Mädchen und ihre Väter gelten, sondern müsste prinzipiell auch für muslimische und jüdische Jungen gegenüber ihren Eltern und Gemeinden gelten. Zwar stehen Religion und religiöse Gemeinschaften unter einem besonderen grundgesetzlichen Schutz, der für Nationalkulturen so nicht gilt, aber die individuellen Rechte können dadurch sicher nicht generell übertrumpft werden. Zu klären ist dann eben noch, ob in Bezug auf die konkret zur Diskussion stehende Praxis eine solche Verletzung von individuellen Rechten vorliegt, ob es also hinreichend starke moralische, das heißt universalisierbare Einwände gegen diese Praxis gibt.
Und diese Frage hat wiederum epistemischen Charakter, was in der Debatte auch deutlich wurde. Einige Autor_innen führten in der Öffentlichkeit ein prinzipielles Argument dafür, dass jeglicher körperliche Eingriff bei Kindern nur vorgenommen werden dürfe, wenn er medizinisch indiziert sei. Dies verweist insofern auf eine Wahrheitsfrage, als dann zu klären ist, ob die Beschneidung von Jungen generell medizinisch indiziert ist, wie es beispielsweise in den USA lange gesehen wurde. Hierbei handelt es sich um eine Frage, die nicht nur epistemisch ist, sondern sogar medizinisch-naturwissenschaftlicher Natur, also auf eine Fachdiskussion jenseits der politischen Debatte verweist.
Andere Autor_innen argumentieren weniger prinzipiell. Sie fassen das Elternrecht etwas weiter als die erste Gruppe und sehen durch dieses auch medizinisch nicht indizierte körperliche Eingriffe gedeckt, solange diese nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden irreversiblen Beeinträchtigungen körperlicher oder psychischer Natur führen. Auch dies verweist auf epistemische, medizinisch-naturwissenschaftliche bzw. psychologische Fragen, die noch etwas komplexer sind: Es ist erst (und dies ist eine normative Frage) zu definieren, wo die Grenzen von Wahrscheinlichkeit, Schwere und Irreversibilität verlaufen, ab denen das kindliche Recht auf Unversehrtheit das Elternrecht übertrumpft. Dann ist eben (und dies ist eine epistemische Frage) zu bestimmen, auf welcher Seite dieser Grenzen die Praxis der Beschneidung liegt. Zudem ist dann auch weiter zu bestimmen, unter welchen Bedingungen die Beschneidung von Knaben auf welcher Seite dieser Grenze liegt. Damit ist auch auf eine komplexe Differenzierungen verschiedener Formen und Kontextbedingungen von Beschneidung verwiesen: Wer nimmt diese wie und in welchem Alter vor? Auf ähnlichen medizinisch-naturwissenschaftlichen Überlegungen fußt auch der in der Debatte von vielen Autor_innen aufgemachte Gegensatz zwischen einer zumindest diskutablen Beschneidung von Jungen und der völlig indiskutablen weiblichen Genitalverstümmelung.
Die Debatten waren freilich in erheblichem Maße belastet:
So drängte die Zeit für die jüdischen und muslimischen Gemeinden, weil einer ihrer zentralen Riten bis auf weiteres strafbar zu sein schien – und dieser Ritus ist zumindest im Judentum auch nicht in Form eines teils als „Kompromiss“ geforderten Moratoriums aufschiebbar, sondern muss relativ verbindlich am achten Tag nach der Geburt vollzogen werden. Für die übergroße Mehrheit nicht nur praktizierender Jüd_innen schien ein Verbot der Beschneidung einer Verunmöglichung jüdischen Lebens in Deutschland gleichzukommen.
Andersherum ist auch klar, dass viele nicht wollten, dass der deutsche Staat insbesondere jüdischen Gemeinden eine solche Situation zumutet – sei es aus ehrlicher Empathie, sei es aus Sorge um den Ruf Deutschlands und die in solchen Zusammenhängen oft befürchteten wirtschaftliche Konsequenzen.
Trotz dieser Komplikationen müsste diese deutsche Beschneidungsdebatte auf den ersten Blick der Traum eine_r jeden Diskursethiker_in oder deliberative_n Demokratietheoretiker_in sein.
3. Der öffentliche Intellektuelle Jürgen Habermas und der Deutsche Bundestag gegen die Deliberation
Der reale Jürgen Habermas sah dies in seiner Rolle als öffentlicher Intellektueller durchaus anders. Er mischte sich – sicherlich aus gutem Grund – nicht direkt in die Niederungen der Beschneidungsdebatte ein. Im Sommer desselben Jahres veröffentlichte er aber in der NZZ einen längeren Essay über Religion und Politik, in dem er kurzerhand den Stab nicht nur über dieser Debatte brach, sondern auch gleich über dem Urteil, das sie auslöste. Eine Illegalisierung der Beschneidung galt ihm als Zeichen der mehrheitskulturellen Anmaßung einer „ausschliessende[n] Definitionsgewalt über die politische Kultur des Landes“. Als Bürger_innen des Landes hätten auch Jüd_innen und Muslim_innen das Recht, „ihre kulturelle und weltanschauliche Identität wahren und öffentlich zum Ausdruck bringen können.“ Verbotsforderungen wertet er gerade nicht als universalistisch, sondern säkularistisch-partikular. Dies könnte man freilich als bloße Positionierung innerhalb der Debatte verstehen; aufgrund der Schärfe von Habermas‘ Urteil scheint es sich mir aber um eine Zurückweisung der Debatte als ganze zu handeln.
Der Deutsche Bundstag schien das durchaus ähnlich zu sehen. Schon relativ früh in der Beschneidungsdebatte signalisierten mehrere Politiker_innen aller Parteien dass sie kein Interesse an einem Verbot der Beschneidung hatten. Die AfD existierte damals noch nicht – kurzes nostalgisches Schweigen – in Linkspartei und SPD gab es auch deutlich hörbare säkularistisch-abweichende Stimmen.
Entsprechend wurde dann schon im Dezember, also nur sieben Monate nach dem Urteil, mit großer Mehrheit ein Gesetz beschlossen, das Beschneidung explizit legalisierte, wenn sie unter bestimmten Bedingungen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Auch wenn es bei Linkspartei und SPD auch abweichende Redebeiträge und Anträge gab, wurde das Gesetz mit einer großen Mehrheit und neben den Stimmen der schwarz-gelben Koalition auch mit zahlreichen Stimmen aus den Oppositionsparteien angenommen.
Mit einigem guten Willen könnte man diesen Prozess aus der Beobachter_innenperspektive so rekonstruieren, dass er gut zu Habermas‘ Demokratietheorie passt: In der informellen Öffentlichkeit fand eine Auseinandersetzung statt, in die sich verschiedene Bürger_innen und Interessengruppen einbrachten; diese Auseinandersetzung wurde dann durch einige Filter – unter anderem eine Ethikkommission – in die formelle Öffentlichkeit des Parlaments getragen, das auf dieser Basis dann eine politische Entscheidung traf. Und weil in den öffentlichen Debatten, unter deren „Belagerung“ das Parlament agierte, nach der notwendigen Filterung normativ das Lager die besten Argumente hatte, das eine Beschneidung für moralisch tolerabel hält, solange sie keine irreversiblen Schäden anrichtet, und sich zudem in den eher epistemisch-kognitiven Debatten zeigte, dass solche Schäden unter den im Gesetz genannten Bedingungen unwahrscheinlich sind, fiel das Gesetz entsprechend aus.
Eine solche Rekonstruktion aus der Beobachter_innenperspektive stünde jedoch in direktem Widerspruch zu den aus der Teilnehmer_innenperspektive geäußerten Eindrücken. Hier bestand weitgehende Einigkeit darüber, dass das Parlament weniger agierte, um das Ergebnis der öffentlichen Deliberation wie auch immer gefiltert umzusetzen, sondern viel eher, um der Debatte ein möglichst zeitiges Ende zu bereiten, den in der Debatte sehr lauten sowie in der Bevölkerung klar mehrheitsfähigen Verbotsforderungen einen Riegel vorzuschieben und zum Alltag überzugehen. Und dieses Vorgehen scheint sich auch mit dem Wunsch des öffentlichen Intellektuellen Jürgen Habermas zu decken.
Nun geht es mir wie bereits erwähnt nicht um die billige Übung, Habermas der Widersprüchlichkeit zu bezichtigen – natürlich kann der politische Philosoph Jürgen Habermas sich darauf beschränken prozedurale Kriterien für Aushandlungen zu formulieren und der öffentliche Intellektuelle Jürgen Habermas in realen Aushandlungen deutlich Position beziehen. Vielmehr geht es mir darum zu zeigen, dass diese Positionierungen auf ein Theorieproblem verweisen, dessen Bearbeitung relevant ist.
Dafür gilt es zunächst zu zeigen, dass es gute rationale Gründe für die Einschätzung von Habermas und das Agieren der deutschen Politik gibt.
4 Gute Gründe für den Abbruch der Debatte aus der Perspektive postkolonialer Repräsentationskritik
Die Gründe, aus denen der Abbruch oder das Nichtstattfinden solcher Debatten wünschenswert sein kann verweisen weniger auf den Bereich politischer Theorie und vielmehr auf den Bereich der Dynamik gesellschaftlicher Diskurse, also auf gesellschaftstheoretische Fragen.
Beschränkte man sich auf Fragen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, also auf die epistemische Qualität der deutschen Beschneidungsdebatte, gäbe es einiges zu monieren. Insbesondere an den Rändern der Debatte tauchen immer Motive auf, die einer sachlichen Prüfung nicht standhalten könnten; so wurden bestimmte, medizinisch problematische Formen der Beschneidung, die in Deutschland kaum eine Rolle spielen, reißerisch beschrieben, als sexueller Missbrauch von Kindern geframed und als relevant für die Legalität von Beschneidung im Allgemeinen dargestellt. Je mehr solcher sachlich verzerrenden Beiträge in einer Debatte auftauchen, desto weniger dürfte es sich um „hinreichend diskursiv geführte[…] Auseinandersetzungen“ handeln. Denn wie gesagt: „Vorurteile zählen nicht“.
Jedoch scheinen mir solche epistemischen Probleme nicht das Hauptproblem der Beschneidungsdebatte von 2012 zu gewesen sein. Das Ausmaß der dort geäußerten Fehldarstellungen scheint gemessen daran, wie öffentlich Debatten eben ablaufen, nicht exzessiv. Ganz wie man sich das beim March 4 Science wünschen würde, wurden im Feuilleton immer wieder medizinische Studien, Expertisen und Statistiken zitiert – freilich ohne, dass damit Klarheit entstanden wäre, weil die Daten sehr widersprüchlich sind. Das heißt nicht, dass dort überall wahr oder gar vorurteilsfrei gesprochen worden wäre. Aber zumindest schien der Wert von Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der offiziellen Öffentlichkeit nicht grundlegend in Frage gestellt worden zu sein, wie es heute im Kontext der Post-Truth-Debatte häufig moniert wird.
Das Problem in der Debatte lag an anderer Stelle, nämlich darin, wer welche Wahrheiten über wen produzieren kann und darf. In Habermas‘ Schriften zu kultureller oder religiöser Differenz finden sich keine entsprechenden Reflexionen: Zwar moniert er im Vorwort zu Nachmetaphysisches Denken II kurz, dass die deutschen Islamdebatten insgesamt „ausgeflippt“ seien, macht aber keine Vorschläge, wie man diese „Ausgeflipptheit“ begrifflich fassen könnte.
Daher suche ich entsprechende Reflexionen an anderer Stelle – und die größte Expertise scheint mir hier in der postkolonialen Repräsentationskritik in der Tradition Gayatri Spivaks vorzuliegen. Nimmt man deren prominente, in Can the Subaltern Speak? formulierte Kritik kolonialer Rettungsdiskurse als Ausgangspunkt – dies kann freilich nur mit deutlichen Transformationen geschehen – stellt sich die deutsche Beschneidungsdebatte ganz anders dar als auf den ersten diskursethischen Blick: Eine kulturelle Mehrheit inszeniert sich als besonders fortschrittlich und rational, indem sie sich zur Retterin der Kinder von Minderheiten vor deren missbräuchlichen Eltern und ihren barbarischen Bräuchen aufschwingt.
Selbst wenn alle in einem solchen paternalistischen Rettungsdiskurs geäußerten Darstellungen den Kriterien propositionaler Wahrheit genügten, wäre es immer noch eine einseitige und undemokratische Produktion von negativen Wahrheiten über Minderheiten. Und es ist gerade diese exzessive Suche nach negativen Wahrheiten über Minderheiten, die weitgehend ohne die Stimmen der betroffenen Männer und Jungen auskommt, die den undemokratischen Charakter dieser Debatte verrät.
Das Problem ist dabei wohlgemerkt nicht, dass über Probleme in Minderheiten gesprochen oder bestimmte Praktiken verboten werden – beides muss in demokratischen Gesellschaften seinen Platz haben. Vollzöge beispielsweise eine kulturelle Minderheit Menschenopfer, wäre die ohne Zweifel öffentlich zu thematisieren und zu verbieten. Auch über Praktiken wie Beschneidung muss eine öffentliche Debatte legitim sein. Das Problem besteht vielmehr in der exzessiven und rational kaum zu rechtfertigenden Fixierung auf vermeintlich „barbarische“ und „rückständige“ Praktiken in Minderheiten. Wäre man um das vielzitierte „Kindswohl“ jüdischer und muslimischer Jungen bemüht, gäbe es zahlreiche Themen, die zu besprechen wären – allem voran wahrscheinlich Armut und ein sozial selektives sowie institutionell diskriminierendes Schulsystem; darüber hinaus Rassismus, Antisemitismus und vieles mehr. In all diesen Sphären könnte man Wahrheiten suchen; stattdessen sucht man Wahrheit in erster Linie in den Unterhosen von ohnehin schon marginalisierten Minderheiten. Weil in kaum eine entsprechende Debatte über Kindswohl in der deutschen Öffentlichkeit je so viel Leidenschaft und Aufmerksamkeit investiert wird wie in solche, in denen die Eltern in Minderheiten als barbarisch und missbräuchlich angegriffen werden, handelt es sich nicht um demokratische, sondern um paternalistische und diskriminierende Debatten.
Besonders offenkundig wird der paternalistische und undemokratische Charakter dieser Debatten auch daran, dass diejenigen, um deren Wohl es gehen sollte, darin gerade nicht auftraten, um den Schutz ihres Wohls vor übergriffigen Eltern zu fordern. Stimmen von in Deutschland nach den hier gängigen Weisen beschnittenen jüdischen und muslimischen Jungen und Männern, die ein Verbot der Praxis forderten, spielten in der Debatte keine nennenswerte Rolle – ganz analog zu dem, was Spivak in Can the Subaltern Speak? moniert.
Freilich kann man diese Dynamiken mit Habermas so beschreiben, dass insbesondere D nicht hinreichend erfüllt war und dann als einen Mangel fassen – es waren keine „hinreichend normativ geführten Auseinandersetzungen“. Im engeren Sinne normativ habe ich über die Debatten auch gar nicht viel mehr zu sagen. Dennoch fügt der – hier nur skizzenhaft eingeführte – Blick der postkolonialen Repräsentationskritik etwas Relevantes hinzu: Die Verstöße gegen diskursethische (Meta-)Normen erscheinen dann nicht als womöglich akzidentieller Mangel, sondern als ein eigener Gegenstand mit Dynamiken und Ursachen, der selbst Gegenstand der Theoriebildung werden kann. Der Mehrwert besteht eben darin, dass mit diesem Ansatz auch Aussagen über die Dynamiken, Ursachen und Bedingungen des „nicht hinreichend Diskursiven“ getroffen werden können.
5 Rekapitulation und Rettung durch den Gesellschaftstheoretiker Jürgen Habermas
Nun zurück zu meinen vier Thesen
- Für Demokratie ist es wichtig, dass in öffentlichen Debatten eine Orientierung an propositionaler Wahrheit bzw. an Wahrhaftigkeit (in einem schwachen, nichtmetaphysischen Sinne verstanden) vorherrscht und entsprechende Verfehlungen skandalisiert und sanktioniert werden.
Diese erste These scheint mir nach dem Gesagten evident. Demokratische Entscheidungen haben oft eine epistemische Dimension und daher muss in entsprechenden Aushandlungen eine gewisse Orientierung an Wahrheit und Wahrhaftigkeit gegeben sein und sollte entsprechend sanktioniert werden – wie erwähnt sagt Habermas dies nicht explizit, setzt es aber wohl stillschweigend voraus.
- Ein zu starker Fokus auf diese Frage von Wahrheit und Wahrhaftigkeit droht jedoch, von einem mindestens ebenso wichtigen Kriterium für die demokratische Qualität öffentlicher Debatten abzulenken, nämlich von der Frage, wer über wen welche Wahrheiten produzieren kann.
Dies ist gewissermaßen nur eine Zuspitzung von D und sollte im letzten Abschnitt deutlich geworden sein. Es handelt sich gewissermaßen um eine Erweiterung von Frieder Vogelmanns gestern geäußerten Thesen: Selbst wenn der Wahrheitsbegriff nicht fundamentalistisch, sondern prozedural-fallibilistisch ist, kann das Instistieren auf dem Produzieren von Wahrheiten über eine Minderheit undemokratische Effekte zeitigen, wenn man nicht mindestens ebenso stark auf Gleichheit und Inklusivität des Prozesses insistiert. Die Orientierung an Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend.
- Wenn reale Debatten gemessen an den Maßstäben aus 1. und 2. eine bestimmte Qualität unterschreiten, kann es normativ wünschenswerter sein, sie würden gar nicht erst geführt.
Die Tatsache, dass die deutsche Beschneidungsdebatte geführt wurde, hat nur dazu geführt, dass ohnehin marginalisierte Minderheiten öffentlich als barbarisch vorgeführt wurden und sich zu Recht noch marginalisierter fühlten. Wie einleitend erwähnt, bin ich mir noch nicht sicher, welche politisch-theoretischen Konsequenzen im engeren Sinne daraus zu ziehen sind. Sicherlich möchte ich damit keine Forderung nach einem Verbot solcher Debatten aussprechen, aber doch zumindest eine Rechtfertigung der vom Bundestag verfolgten diskursabbrechenden Handlungsweise – ohne dass ich allen Abgeordneten die von mir gegebenen Gründe zuschreiben möchte.
- Politische Theorie muss sich – insbesondere, wenn sie realen Diskursen und Aushandlungen normatives Gewicht aufbürdet – für eine gesellschaftstheoretische und ideologiekritische Reflexion öffnen, um nicht selbst ideologische Effekte zu zeitigen.
Dies ist meine programmatische Forderung an die politische Theorie. Ich habe sie hier am Beispiel von Habermas‘ Demokratietheorie formuliert, aber dasselbe gilt eher noch verschärft für die verschiedenen gestern zitierten radikalen Demokratietheorien: Politische Theorie hat gute Gründe, das normative Gewicht, das sie selbst nicht (mehr) tragen kann, den realen gesellschaftlichen Aushandlungen zu übertragen. Wenn sie dies tut, muss sie sich aber auch dafür interessieren, unter welchen Bedingungen diese Aushandlungen dieses Gewicht auch tragen können und demokratisch verlaufen. Wenn politische Theorie das nicht tut, produziert sie selbst Ideologie und adelt einen herrschaftlichen und antiegalitären Prozess als den möglichst demokratischen. Politische Theorie muss sich für die ideologischen Dynamiken von öffentlichen Aushandlungen – Seyla Benhabib spricht in solchen Zusammenhängen von Jurispathos – interessieren und die Ursachen thematisieren: Machtdifferenziale, Subjektivierungsformen, pathische Projektion, institutionelle Diskriminierung, ein Rückschlagen ökonomischer Verhältnisse usw.
Nun kommt, direkt bevor der Vorhang fällt, noch wie angekündigt der Gesellschaftstheoretiker Jürgen Habermas auf die Bühne geritten: Der Grund, aus dem ich sein theoretisches Modell trotz der oben skizzierten Probleme für das attraktivste halte, ist, dass es zur politischen Theorie noch eine weitgehend in denselben Begrifflichkeiten verfasste Gesellschaftstheorie gibt. Und in dieser gibt es mit dem zugegebenermaßen eher randständigen Konzept der systematischen verzerrten Kommunikation auch eine Kategorie in sich die von mir geforderte ideologiekritische Reflexion vollziehen kann – wenn man denn bereit ist, es entsprechend zu expandieren und zum Beispiel postkoloniale Argumente aufzunehmen.